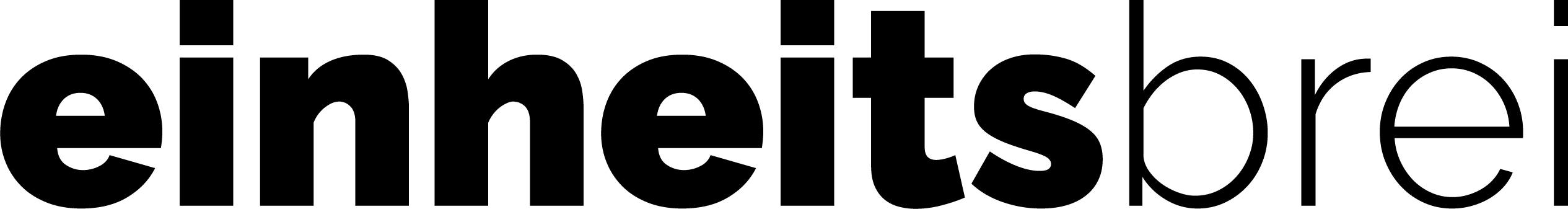Bánh cuốn: „Wir sind auch das Volk!“, die vergessenen Ostdeutschen
Von: Annette Rosner und Isabelle Schwab
“Wir sind das Volk” – das war der Slogan der friedlichen Revolution. Es war der Spruch, der die Mauer und schließlich auch die DDR zu Fall brachte. Die Deutsche Wiedervereinigung wurde zum weltweiten Freudenfest. Wer dabei vergessen ging: die Vertragsarbeiter*innen der DDR und damit 60.000 Vietnames*innen. Für sie begann nach 1989 ein zäher Kampf um Bleiberecht und Anerkennung.
Die Geschichte der Vertragsarbeiter*innen reicht zurück bis in die 1960er-Jahre. Damals warb die DDR Arbeitskräfte aus sozialistischen „Bruderstaaten“ an: aus Mosambik, Angola, Kuba, Polen. Und besonders viele ab 1980 aus Vietnam. Das Land war nach 20 Jahren Krieg ausgeblutet, die Armut groß. Für viele junge Vietnames*innen klang das Versprechen der DDR verlockend: eine Ausbildung, sichere Arbeit, genug Geld, um die Familie zu Hause zu unterstützen.
Foto: Bundesarchiv / Rainer Weisflog, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 DE
Doch die Realität war anders. Eingesetzt in schlecht bezahlten und körperlich anstrengenden Fabrikjobs, lebten die Vertragsarbeiter*innen eng zusammengepfercht in Wohnheimen, oft zu viert in einem kleinen Zimmer. Privatsphäre gab es kaum, und ihr Leben war streng reglementiert: Männer und Frauen wurden getrennt untergebracht, selbst wenn sie verheiratet waren. Kinder kriegen war verboten. Wer schwanger wurde, musste abtreiben oder das Land verlassen. Vom Gehalt der Vertragsarbeiter*innen wurden Miete und zwölf Prozent für die „Wiederaufbauhilfe“ in Vietnam abgezogen. Und weil die DDR-Mark nicht frei umtauschbar war, schickten viele statt Geld Fahrräder, Nähmaschinen oder Kameras nach Hause – Dinge, die dort dringend gebraucht wurden – aber auch in der DDR Mangelware waren.
“Kein Rassismus im Sozialismus”
Die Stimmung gegenüber den Vertragsarbeiter*innen in der DDR war ambivalent. Offiziell stellte die Staatsführung die Vietnames*innen als „fleißige Freunde“ dar, als Zeichen internationaler Solidarität. „Rassismus gibt es im Sozialismus nicht“, so die offizielle Partei-Parole. Doch in der Bevölkerung wuchs Missgunst – in der Mangelwirtschaft waren Vietnames*innen zur unliebsamen Konsumkonkurrenz geworden und kosteten angeblich viel Geld. Dabei waren es vor allem die Überwachungsmaßnahmen in den Wohnheimen, die teurer waren. Und durch die Arbeitskraft der Vietnames*innen wurde die Wirtschaft der DDR kräftig angekurbelt.
Die rassistische Gewalt, die Vertragsarbeiterinnen in den 80er-Jahren traf, wurde von der machthabenden Sozialistischen Einheitspartei, der SED, systematisch verharmlost. Aufgearbeitet wurde das bis heute nur wenig. Der Historiker Harry Waibel fand in Archiven Hinweise auf mehr als 700 rassistische Angriffe während der DDR-Zeit. Vierzig Mal wurden Wohnheime attackiert. Tote gab es auch. Von Stasi und SED-Führung wurde das alles als „Rowdytum“ abgetan.
1989 kam dann der große Umbruch. Am 7. Mai deckten Bürgerinitiativen den massiven Wahlbetrug der Kommunalwahl auf – ein Moment, den Historiker heute als Startpunkt der friedlichen Revolution sehen. Ab diesem Tag wurde jeden Monat demonstriert, immer lauter, immer mutiger. Als am 9. November schließlich die Mauer fiel, feierten die Deutschen. Aber die Vertragsarbeiter*innen standen vor dem Nichts.
Gehen oder bleiben?
Über Nacht verloren sie ihre Arbeitsplätze, ihren Wohnort und ihre Aufenthaltstitel. Schnell wurde klar: Mit dem Ruf „Wir sind das Volk!“ waren sie nicht mitgemeint. Die Bundesrepublik wollte sie so schnell wie möglich loswerden, bot Rückkehrprämien und Flugtickets an. Doch die vietnamesische Regierung wollte viele nicht zurücknehmen. Rund 16.000 blieben, oft nur mit Duldungen, die manchmal nur wenige Wochen gültig waren. Ein normales Leben war so kaum möglich. Manche hielten sich mit Schwarzmarktgeschäften über Wasser, etwa dem Zigarettenhandel. Andere gründeten kleine Unternehmen: Reisebüros, Blumenläden oder Imbisse, die bis heute das Stadtbild an vielen Orten prägen.
Doch die 1990er-Jahre brachten nicht nur Unsicherheit, sondern auch offene Gewalt. Im Osten entstand ein Vakuum aus Arbeitslosigkeit und rechtsfreiem Raum. Neonazis nutzten die Gunst der Stunde, erklärten Stadtteile zu „national befreiten Zonen“ und griffen Migrant*innen brutal an. Die Bilder von Rostock-Lichtenhagen 1992 gingen um die Welt: ein Wohnheim für Vietnamesinnen in Flammen, grölende Menschenmassen, eine Polizei, die tagelang nicht eingriff.
Vietnames*innen lebten jetzt nach eigenen Regeln: nachts nicht raus, nie allein unterwegs sein. Es waren die „Baseballschlägerjahre“, in denen Angst das Leben von Migrant*innen bestimmte.
Wir sind auch das Volk
Und doch gaben sie nicht auf. Vietnames*innen organisierten sich in Vereinen wie der „Reistrommel e.V.“, protestierten, schrieben Petitionen, machten öffentlich, wie prekär ihre Lage war. In dieser Zeit entstand auch der Slogan: „Wir sind auch das Volk!“ – eine bewusste Antwort auf die Rufe von 1989, die sie ausgeschlossen hatten. Erst 1997 erhielten die vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen ein dauerhaftes Bleiberecht. Andere ehemalige Vertragsarbeiter*innen kämpfen bis heute um Anerkennung.
Foto: ddrbildarchiv.de/Burkhard Lange
Heute gehören vietnamesische Restaurants, Läden und Kultur selbstverständlich zu Deutschland. Die Kinder und Enkel der ehemaligen Vertragsarbeiter*innen sind hier aufgewachsen, studieren, arbeiten, gründen Familien. Doch die Geschichte ihrer Eltern und Großeltern wirkt nach. Sie erinnert daran, dass Integration nicht von selbst geschieht – und dass Zugehörigkeit oft erkämpft werden muss.
Vegane Bánh Cuốn (vietnamesische Reismehlröllchen) von Ana Romas
4
servingsZutaten
- Für den Teig:
200 g Reismehl
50 g Tapiokastärke
750 ml Wasser
1 EL neutrales Öl
½ TL Salz
- Für die Füllung:
200 g fester Tofu (fein zerbröselt) oder veganen Hack
100 g Austernpilze, sehr fein gehackt
2 kleine Schalotte, fein gewürfelt
1 EL Sojasauce
1 EL neutrales Öl
Salz & Pfeffer nach Geschmack
- Für das Topping & Beilagen:
2 EL Röstzwiebeln
2 EL Frühlingszwiebeln, in Ringen
Frische Kräuter (Koriander, Minze)
Sojasprossen (kurz blanchiert)
Gurken- oder Karottensticks
- Für die Nước Chấm-Sauce
3 EL Sojasauce
3 EL Limettensaft
2 EL Wasser
1 EL Zucker (oder Agavendicksaft)
1 kleine Chili, fein gehackt
1 Knoblauchzehe, fein gehackt
Anweisungen
- Zubereitung:
- Teig herstellen: Reismehl, Tapiokastärke, Salz, Wasser und Öl glatt verrühren, bis keine Klümpchen mehr da sind. Mindestens 30 Minuten ruhen lassen.
- Füllung vorbereiten: Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebelwürfel anbraten. Tofu oder Hack und Pilze dazugeben, mit Sojasauce, Salz und Pfeffer würzen. Unter Rühren braten, bis die Flüssigkeit verdampft ist. Beiseite stellen.
- Reismehlteig dämpfen: Eine beschichtete Pfanne (oder einen großen Deckel-Dämpfaufsatz) ganz leicht einfetten. Eine dünne Schicht Teig hineingießen, schnell schwenken, sodass ein hauchdünner Crêpe entsteht. Deckel auflegen und 1–2 Minuten garen, bis der Teig transparent ist. Vorsichtig herauslösen.
- Füllen und rollen: Den noch warmen Reismehl-Crêpe auf ein geöltes Brett oder Teller legen, 1–2 TL Füllung in die Mitte geben und vorsichtig aufrollen. Mit dem restlichen Teig und der Füllung wiederholen.
- Anrichten:
- Die Röllchen auf Tellern anrichten, mit Röstzwiebeln, Frühlingszwiebeln und frischen Kräutern bestreuen. Mit Sojasprossen, Gurken- und Karottensticks servieren. Dazu die vegane Nước Chấm reichen.