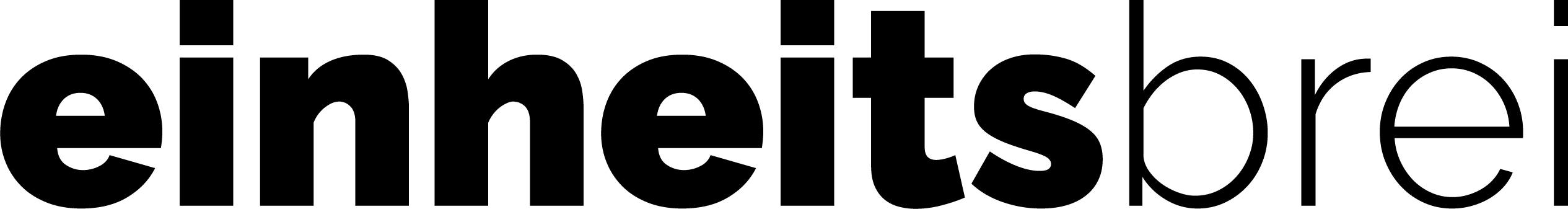Fırınlama: Das ewige Ankommen als «Gast»-Arbeiter
Von: Isabelle Schwab
Fırınlama ist ein einfaches Gericht: Hühnchen, Paprika, Tomatenmark und Butter in den Ofen schieben und fertig. So hat das Cemal Koçaş in den 1980ern für seinen Vater, Bruder und Onkel gemacht. Damals waren sie sogenannte “Gastarbeiter” in der Bundesrepublik.

Mit dem Kissen über dem Kopf, so hat Cemal Koçaş versucht zu schlafen, als er 1981 frisch in Westdeutschland war. Aber es ging einfach nicht. Zu fremd fühlte er sich in der Zweizimmerwohnung, die er jetzt mit Bruder, Vater und Onkel teilte. Zu sehr vermisste er Freunde und Familie in der Türkei. Die Gerüche, Menschen, Sprache: Alles war neu für ihn. Koçaş war erst 15 Jahre alt.
Eigentlich wollte er gar nicht nach Westdeutschland kommen. Er war tief in seiner Region verwurzelt und war als Teil einer Kindertanzgruppe bereits national bekannt. Zehn Auftritte hatte er als Tänzer im türkischen Fernsehen. Sollte er das wirklich aufgeben? Sein Vater versicherte ihm: In Deutschland kannst du weiter Musik machen. Und dir eine bessere Zukunft aufbauen. Komm jetzt, sonst verpasst du deine Chance. Die Zeit drängte, denn Ende 1981 sollte der Familiennachzug für über 16-Jährige ausgesetzt werden.
Koçaş wagte die Reise. Und mit ihm viele Türkinnen und Türken in dieser Zeit. Während die italienischen, portugiesischen und andere “Gastarbeiter*innen” in ihre Herkunftsländer zurückkehrten, waren Türk*innen die einzige Gruppe an Ausländer*innen, die ab dem Anwerbestopp 1973 bis 1980 – vor allem durch den Familiennachzug – wuchs: von 1 Million im Jahr 1974 auf 1,4 Millionen im Jahr 1980.
“Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.” – Max Frisch
Sie waren seit fast zwei Jahrzehnten Teil des westdeutschen Arbeitsmarktes. Und doch gab es kaum Integrationsmaßnahmen. Man ging immer noch davon aus, dass die “Gäste” wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren würden. Deutschland tat sich mit dem Wandel zum Einwanderungsland schwer.
Koçaş durfte an einer “Maßnahmen zur Berufsvorbereitung und sozialen Eingliederung” (kurz MBSE) teilnehmen. Drei Tage Werkstatt und zwei Tage Sprachkurs. “Das Ziel war, die Kinder von Gastarbeitern besser auf die Fabrikarbeit vorzubereiten”, sagt Koçaş. “Dass man Feilen kann, Löten kann. Und mit dem Arbeitgeber reden kann.”
Als er ein Jahr später eine Ausbildung beginnt, ist er auf sich alleine gestellt. Es gibt keine Übersetzer oder türkischsprachigen Pädagogen. Koçaş hat Probleme, dem Unterricht zu folgen. Durchsucht nächtelang Wörterbücher. Versucht, sich durchzuschlagen. “Ich werde den Begriff ´Verdichtungsverhältnis´ nie vergessen”, sagt er trocken. “Ich habe ihn in keinem einzigen Wörterbuch gefunden.”
Nicht am Unterricht teilnehmen zu können, keine Unterstützung zu finden, das hat Koçaş fertig gemacht. Er bricht die Schule ab. Arbeitet von nun an in einer Kunststofffabrik. Die nächsten Jahre sind geprägt von körperlich schwerer Arbeit und “Mobbing”, wie Koçaş es nennt.
“Türkenhaß” in der BRD
In der BRD entwickelte sich in dieser Zeit ein regelrechter “Türkenhass”. Türk*innen erfuhren als “fremdeste” der Einwander*innen besonders viel Diskriminierung, Hass und Gewalt. Doch die Polizei erfasste rechtsextreme Gewalt nicht als solche.
Bereits 1984 in Duisburg-Wanheimerort und 1988 in Schwandorf gab es Brandanschläge, bei denen gezielt türkische Familien angegriffen wurden. Neonazis und völkische Gruppierungen gewannen in dieser Zeit in der BRD an Zulauf. Dieser Trend setzte sich nach dem Fall der Mauer 1989 fort. Während Deutsche ohne Migrationsgeschichte feierten, bangten Einwander*innen um ihr Leben.
Es begann die heute als “Baseballschlägerjahre” bekannte Zeit. Die Brandanschläge in Mölln, Solingen und Rostock-Lichtenhagen bleiben unvergessen: Anwohner grölen, während Jugendliche Wohnheime von Vertragsarbeiter*innen aus der DDR und Gastarbeiter*innen aus der BRD angreifen, die Polizei steht tagelang untätig daneben.
Auch Koçaş erinnert sich, dass nach der Wiedervereinigung der Rassismus schlimmer wurde. Was ihm in dieser Zeit Halt gegeben hat, war die Musik. Zusammen mit Deutschen spielte er in einer Ethno-Rock-Band. “Da hatte ich das Gefühl, dazuzugehören, hier erwünscht zu sein.”
Wenn Koçaş sich heute erinnert, wie er in den 80ern Fırınlama gekocht hat, erinnert er sich, vor allem an ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. “Man hat nie so gespürt wie heute, dass man in einem fremden Land lebt. Wahrscheinlich weil wir Hoffnung hatten, dass es besser werden kann”, erzählt er. “Heute empfinde ich Migration als eine Erkrankung, die man überallhin mitschleppt, und nie loswerden kann.”
Ende der 90er-Jahre hat Koçaş Soziale Arbeit studiert. Er arbeitet heute als Sozialarbeiter in Bremen. Und ist Geschäftsführer des Vereins “Ein Haus für unsere Freundschaft”. Heute, 2025, zieht er ein trauriges Fazit: “Trotz all der erfolgreichen Arbeit, gesellschaftlichen Teilhabe, Mitgestaltung der Gesellschaft, politischen, kulturellen und sozialen Mitwirkung, der Übernahme von politischer Verantwortung: Man wird das Gefühl nie loswerden, dass man nicht ganz dazugehört.”
Türkische Ofenkartoffeln mit veganem Paprika-„Hähnchen“ von Ana Romas
4
servingsZutaten
400–500 g vegane Hähnchenfilets (z. B. auf Soja- oder Erbsenbasis)
800 g Kartoffeln
2 Gemüsezwiebeln
2 rote Spitzpaprika
2 Tomaten
3 Knoblauchzehen
2 EL Tomatenmark
200 ml Gemüsebrühe
2 TL Paprikapulver edelsüß
1 TL Kreuzkümmel
½ TL Salz
½ TL Pfeffer
- Für die Marinade:
3 EL Sojajoghurt (ungesüßt)
1 EL Paprikamark (Biber Salçası)
1 TL Thymian
½ TL Salz
½ TL Pfeffer
1 EL Olivenöl
Anweisungen
- Marinade anrühren: Alle Zutaten der Marinade gründlich vermischen, bis sich alles gut verbunden hat.
Vegane Filets marinieren: Die veganen Hähnchenfilets in der Marinade wenden und mindestens 1 Stunde ziehen lassen, besser über Nacht. Wer mehr Geschmack möchte, kann auch die Kartoffeln mit etwas Marinade mischen (dafür die Menge verdoppeln). Die Kartoffeln vorher in Spalten schneiden. - Gemüse vorbereiten: Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika und Tomaten in grobe Stücke schneiden. Zusammen mit Knoblauch, Tomatenmark, Brühe und den Gewürzen in eine große Ofenform geben und gut vermengen.
- Filets hinzufügen: Die marinierten veganen Hähnchenfilets oben auf das Gemüse legen. So bräunen sie schön und geben Aroma an die Kartoffeln ab.
Backen/Grillen: Den Backofen oder Grill auf 180–200 °C (Umluft/indirekte Hitze) vorheizen. Die Form in die Mitte schieben, nicht direkt über die Flamme.
Schmoren: Alles für ca. 45–55 Minuten garen, bis die Kartoffeln weich und das Gemüse saftig ist. Zwischendurch einmal umrühren oder mit etwas Flüssigkeit vom Boden der Form übergießen.