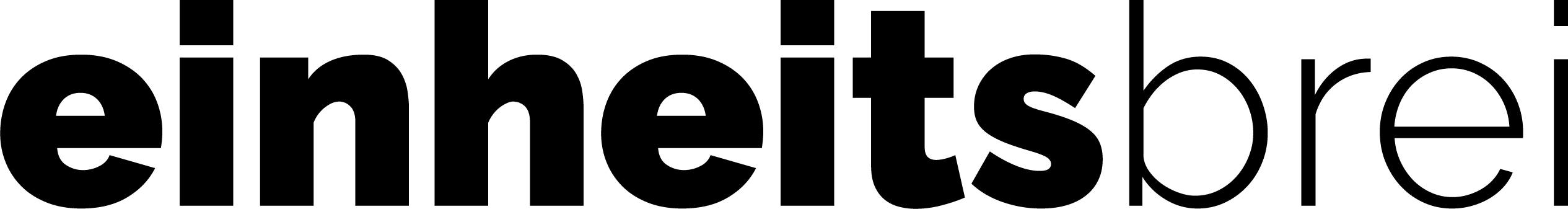Let them eat Bananenbrot: Wie die DDR ´89 zusammenbrach
Von: Isabelle Schwab
Stell dir vor: Du gehst in den Supermarkt und findest weder Kaffee noch Bananen, vernünftige Schokolade ist sowieso nicht zu kriegen und für dein dreijähriges Kind ist keine passende Kinderkleidung zu finden. So war das für Millionen Menschen in der DDR Ende der 80er-Jahre. Und gleichzeitig lebte die politische Elite in Saus und Braus.
Foto: BStA, eastblockworld, EBW_PH_1210131
Ein Tag der diese Unterschiede auf den Punkt bringt ist der 7. Oktober 1989 – der 40. Geburtstag der DDR. Die Parteispitze der Sozialistischen Einheitspartei (SED) feierte im Palast der Republik mit hochrangigen Gästen: Gorbatschow war aus Russland angereist, Arafat aus Palästina. Und sie ließen es sich gut gehen: Auf dem Menu standen Kaviar, Sekt, edle Desserts und zum Beispiel auch Pistazienklößchen. Vor den Türen des Palasts begann der Protest.
Ungleichheit in der „klassenlosen“ Gesellschaft
Für die meisten DDR-Bürger*innen war das Leben geprägt von einem System, das die eigenen Versprechen nicht hielt. Die SED hatte eine „klassenlose Gesellschaft“ versprochen. Doch die Realität sah anders aus. Grundnahrungsmittel wie Fleisch und Milch, aber auch Kleidung und andere Waren gingen regelmäßig an den Export, um Devisen zu erwirtschaften, während die eigenen Leute für Alltagsgegenstände stundenlang anstanden. Oft auch vergeblich.
Für ein Auto musste man 15 bis 25 Jahre warten. Für ein Telefon? Mindestens zwei Jahre. Die Verkaufsgespräche begannen meist mit „Haben Sie…?“ und endeten mit „Ham‘ wa nich!“. Das prägte eine ganze Generation.
Foto: BStA, eastblockworld, EBW_PH_1227905
Die Wirtschaftsplaner*innen fokussierten sich auf Schwerindustrie, wie Stahl- und Eisenproduktion, und Export, während Konsumgüter, also Kleider, Möbel oder sowas wie ein Fernseher, vernachlässigt wurden. Das Ergebnis: eine aufgestaute Inflation von sechs Milliarden Mark. Die Menschen hatten Geld, aber nichts zu kaufen. Deshalb stieg zwischen 1980 und 1989 beispielsweise der Preis für Kleider um über 30 Prozent.
Während die Mehrheit mit dem Mangel kämpfte, lebte die politische Elite in einer anderen Welt. Die Waldsiedlung Wandlitz, etwa 30 Kilometer nördlich von Berlin, war das perfekte Symbol für diese Ungleichheit. Hier wohnten Erich Honecker, Walter Ulbricht und andere Spitzenfunktionäre in luxuriösen Häusern mit bis zu 15 Zimmern, abgeschirmt vom Rest der Welt durch eine zwei Meter hohe Betonmauer.
Die Siedlung bot alles, was normale DDR-Bürger*innen nicht bekommen konnten: Einen Laden mit Westprodukten zu Schleuderpreisen, Kino, Kegelbahn, Schwimmhalle mit Sauna und einen exklusiven Funktionärsclub. Ein Leben, das für die normale Bevölkerung undenkbar war.
Historiker*innen sehen in Wandlitz heute ein zentrales Symbol für eine Staatsführung, die ihre Macht auf Kosten der eigenen Bevölkerung missbrauchte. Während sich die Elite vom Rest des Volkes abschottete, wuchs der Frust in der Bevölkerung.
Der 7. Oktober 1989: Tag der Gegensätze
Am 7. Oktober 1989 prallten die zwei Welten aufeinander. Vormittags fand die traditionelle Militärparade auf der Karl-Marx-Allee statt, nachmittags gab es Volksfeste, und abends den festlichen Empfang im Palast der Republik mit internationalen Gästen. Ehrengast war Michail Gorbatschow, der das SED-Regime zur Erneuerung ermahnte: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“. Doch da war es eigentlich schon zu spät.
Wenige hundert Meter entfernt demonstrierten Menschen für Freiheit und Demokratie. Sie hatten genug von der Heuchelei, von endlosen Warteschlangen, von Wahlbetrug und einer Politik, die sie ignorierte. Schon seit den gefälschten Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 gingen Menschen jeden Monat auf die Straße. Damals hatten Wahlbeobachter*innen von Bürgerorganisationen den systematischen Wahlbetrug der SED aufgedeckt.
Die Stimmung war also am 7. Oktober ´89 explosiv. Volkspolizei und Stasi gingen brutal gegen Demonstrant*innen vor. Vor den Kameras des westdeutschen Fernsehens. Die Menschen riefen „Gorbi, hilf uns!“, „Wir sind das Volk!“ und „Freiheit!“. Es war der Moment, in dem die Scheinheiligkeit des Systems für alle sichtbar wurde.
Foto: BStA, eastblockworld, EBW_PH_1206045
Foto: BStA, eastblockworld, EBW_PH_1334414
Mit “Wir sind das Volk!” war der wichtigste Slogan der Friedlichen Revolution geboren. Er brachte auf den Punkt, was viele fühlten: Die SED-Führung hatte den Bezug zum Volk verloren. Und: Er stand für den Wunsch, das Land mitzugestalten. Aus dem ursprünglichen „Wir wollen raus!“ wurde immer öfter ein trotziges „Wir bleiben hier!“. Die Menschen wollten ihr Land nicht mehr verlassen. Sie wollten es verändern. Am 9. Oktober demonstrierten in Leipzig bereits Zehntausende, trotz massiver Polizeipräsenz. Die Sicherheitskräfte griffen nicht ein. Ein entscheidender Moment. Nur fünf Wochen nach dem 40. Jahrestag fiel die Berliner Mauer. Die Proteste vom 7. Oktober 1989 zeigten der Welt, dass das SED-Regime am Ende war.
Der 7. Oktober 1989 bleibt bis heute ein Symbol dafür, wie wichtig es ist, dass Politik nah bei den Menschen bleibt. Das System der DDR hielt 40 Jahre, bis es kollabierte. Und es reichten am Ende einige Monate, um alles zu ändern.
Foto: BStA, eastblockworld, EBW_PH_1205342
Bananenbrot von Ana Romas
1
KastenformZutaten
3 reife Bananen (ca. 300 g Fruchtfleisch)
80 ml Pflanzenöl (z. B. Raps- oder Sonnenblumenöl)
80 g brauner Zucker oder Kokosblütenzucker
1 TL Vanilleextrakt oder 1 Päckchen Vanillezucker
2 EL Chia-Samen + 6 EL Wasser (als Ei-Ersatz)
200 g Weizenmehl (Type 405/550) oder Dinkelmehl (630)
50 g Haferflocken (zart oder kernig)
2 TL Backpulver
1 TL Natron
1 TL Zimt
1 Prise Salz
80 g gehackte Walnüsse oder Haselnüsse (alternativ Sonnenblumen- oder Kürbiskerne)
optional: 50 g Zartbitterschokolade, grob gehackt
optional: 2 Eier
Anweisungen
- Chia-Samen mit 6 EL Wasser verrühren und ca. 10 Minuten quellen lassen, bis eine gelartige Masse entsteht.
- Bananen mit einer Gabel fein zerdrücken. Öl, Zucker, Vanille und die Chia-Mischung dazugeben, gut verrühren.
- In einer zweiten Schüssel Mehl, Haferflocken, Backpulver, Natron, Zimt und Salz vermengen.
- Die Mehlmischung vorsichtig unter die Bananenmasse heben. Nicht zu lange rühren, sonst wird das Brot zäh.
- Gehackte Walnüsse oder Kerne (und ggf. Schokolade) unterheben. Den Teig in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Kastenform füllen. Bei 180 °C Ober-/Unterhitze ca. 50–55 Minuten backen (Stäbchenprobe machen).
- Vor dem Anschneiden mindestens 20 Minuten in der Form auskühlen lassen.